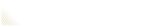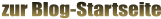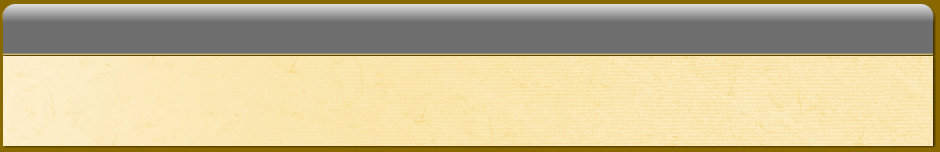


Anguckallergie
Inez Maus
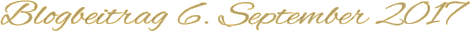
Diese Frage wird mir nach einer grundlegenden Einführung in die Thematik Autismus in einer Diskussionsrunde
gestellt, wobei die Teilnehmer keine oder nur wenige persönliche Berührungspunkte mit Autismus haben, aber an dem
Thema interessiert sind.
Die Antwort ist schnell gegeben: „Nein. Ich habe meine Kinder nicht konsequent erzogen.“ Die Begründung der Antwort
lässt sich jedoch nicht so schnell geben, dazu bedarf es einiger Erklärungen.
Das Adjektiv konsequent leitet sich von dem lateinischen Wort consequens ab, welches folgerichtig bedeutet. Im
heutigen Sprachgebrauch wird konsequent allerdings seltener im Sinne von sachlich oder logisch zwingend (also
folgerichtig) gebraucht, sondern meist im Sinne von unbeirrbar oder fest entschlossen.
In der Erziehung von Kindern wird Konsequenz üblicherweise dahingehend interpretiert, dass aufgestellte Regeln
durchgesetzt und Regelverstöße bestraft werden, wobei die Strafe einen logischen Bezug zum Verstoß haben sollte.
Erziehungsratgeber versprechen, dass ein frühzeitiges Aufstellen und Einhalten von Regeln dazu führt, dass Kinder
immer seltener versuchen, die definierten Grenzen zu überschreiten. Konsequente Erziehung versteht sich also in
Bezug auf das Schaffen von Regeln als beharrliches, eisernes, entschlossenes, geradliniges, hartnäckiges,
standhaftes, unbeirrtes, zielstrebiges … Verhalten und birgt somit die Gefahr des Beschneidens von Freiraum, des
Verhinderns von Erfahrungen oder des Beschränkens der Entscheidungsfreiheit. Lediglich bezüglich der Reaktion auf
Regelverstöße versteht sich konsequente Erziehung bei einer guten Praxis als folgerichtig.
Wie erzieht man die Kinder einer Familie konsequent, wenn sich ein Kind der Familie konsequent (im Sinne von
hartnäckig …) der Erziehung entzieht? Wenn ein Kind Regeln nicht versteht, Bedürfnisse nicht äußern kann, auf
Anweisungen oder Bitten nicht reagiert?
Ein Kind mit Autismus in der Familie bedeutet, dass ständig kreative Lösungen für ganz alltägliche Probleme gefunden
werden müssen, dass Regeln gedehnt werden oder entfallen, weil sie nicht verstanden werden oder aufgrund
autismustypischer Besonderheiten nicht eingehalten werden können.
Ein Kind mit Autismus in der Familie bedeutet auch, dass viele Regeln, die Eltern als selbstverständlich empfinden,
plötzlich hinterfragt werden, weil ein Kind in der Familie lebt, welches die entsprechende Regel nicht bricht. Weil dieses
besondere Kind nicht zu den Buntstiften greift und auf der Tapete malt. Weil es niemals einen Stift in die Hand nimmt,
weil es keine Kinderzeichnungen produziert, die die Eltern dann stolz an eine Korkwand pinnen können. Augenblicklich
sind die Malereien der anderen Kinder auf der Tapete des Wohnzimmers etwas ganz Wertvolles, etwas, das mit
anderen Augen betrachtet wird – etwas, das man sich auch von dem besonderen Kind erträumt. Die einzige denkbare
Konsequenz (im Sinne von folgerichtig) in der Erziehung der Kinder ist in diesem Fall, den Kindern eine begrenzte
Tapetenfläche zur Verzierung zuzuweisen, aber nicht, ihnen das Malen auf der Tapete zu untersagen. Viel zu kostbar
ist dieses Malen, auch wenn das gewährende Zuschauen der Eltern von ständiger Wehmut begleitet wird.
Aufgrund der besonderen familiären Situation durften unsere Kinder ohne Autismus einerseits viele Dinge
ausprobieren, die in anderen Familien verboten waren. Sie hatten Freiräume und Befugnisse, die befreundete Kinder
nicht kannten. Es macht keinen Sinn, einem Kind etwas zu verbieten, wozu man das andere Kind verlocken möchte.
Was ein Kind ausprobieren darf, wozu ein Kind ermutigt wird, das sollte auch für das andere Kind gelten.
Andererseits galten bei uns viele Regeln, die von uns nicht bewusst aufgestellt wurden, sondern die uns das Verlangen
nach einem möglichst harmonischen Alltag diktiert hat. Dazu gehörten eine Minimierung von bestimmten sensorischen
Reizen, damit das Kind mit Autismus nicht permanent von seiner abweichenden Wahrnehmung überfordert wird, sowie
eine gewisse Gleicherhaltung räumlicher und zeitlicher Strukturen. Diese Regeln ergaben sich aus der logischen
Konsequenz eines adäquaten Umgangs mit dem Autismus des einen Kindes und wurden permanent an die aktuellen
Gegebenheiten angepasst. Diese Regeln zeichneten sich nicht durch konsequente Starre aus, sondern durch ihre
Flexibilität, um den Alltag für alle Familienmitglieder konsequent bestmöglich zu gestalten.
Trotz (oder vielleicht aufgrund?) mangelnder Konsequenz in der Erziehung im herkömmlichen Sinne haben unsere
Kinder gelernt, dass es Dinge gibt, die verhandelbar sind, und solche, die man als gegeben akzeptieren muss. Sie
haben gelernt, dass Bedingungen sich ständig ändern und somit neue Regeln verhandelt werden können oder
aufgestellt werden müssen. Und sie haben aus der besonderen Familiensituation etwas sehr Wertvolles
mitgenommen: Sie gehen nicht grundlos auf die Barrikaden, rebellieren nicht blind, sondern haben den Mut entwickelt,
auch außerhalb der vertrauten Umgebung der Familie Dinge, Regeln oder Gegebenheiten kritisch zu hinterfragen und
ihre Argumente sachlich darzulegen.
Eine besondere Form der konsequenten Erziehung ist die liebevolle Konsequenz, wobei es darum geht, die Kinder
nicht zu bestrafen, sondern aus den Konsequenzen, die ihre Handlungen ergeben, lernen zu lassen. Ein Kind, das
beispielsweise nicht essen will, muss nicht essen, bekommt aber erst zur nächsten festgelegten Mahlzeit etwas
Nahrhaftes. Für mich bedeutet die Konstruktion liebevolle Konsequenz einen Widerspruch in sich. Ein derartiges
konsequentes Handeln mag zwar aus Liebe zum Kind vollführt werden, ist aber keineswegs eine liebevolle, also
zärtliche Handlung. Liebevolle Handlungen sind für mich Kuscheln, das Lesen von Geschichten, interessante
Gespräche – alles, was mein Kind mit mir zusammen gern tun möchte.
Und wie praktiziert man nun liebevolle Konsequenz am Beispiel des Essens, wenn das Kind mit Autismus keinen
Hunger oder kein Sättigungsgefühl spürt und rigide Essensvorlieben aufweist, die nur in minimalen Spielräumen
beeinflussbar sind?
Wir haben unsere Kinder weder im konventionellen Sinne noch liebevoll konsequent erzogen, aber wir haben
konsequent darauf geachtet, dass ihnen nichts zustößt, dass sie nicht ertrinken, nicht in ein fahrendes Auto laufen …
Wir haben ihnen beigebracht, eigene Erfahrungen zu machen, Entscheidungen zu treffen, Gefahren zu erkennen und
in gefährlichen Situationen adäquat zu reagieren.

"Haben Sie Ihre Kinder konsequent erzogen?"

© Inez Maus 2014–2025