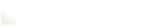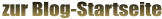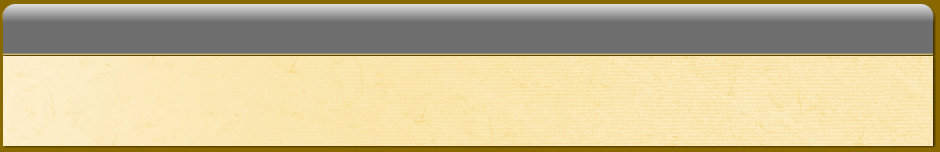


Anguckallergie
Inez Maus
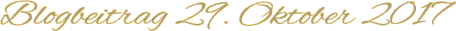
Alle haben Träume. Das sind einerseits die Erlebnisse, die uns des Nachts in unterschiedlicher
Form ereilen, und das sind andererseits die Pläne, die wir für unser Leben schmieden, und die
Wünsche, auf deren Erfüllung wir hoffen.
Wir träumen von einem verständnisvollen Partner, von der ewigen Liebe, vielleicht von einer
traumhaften Hochzeit und dann von zauberhaften Kindern. Alles ist auf Perfektion ausgelegt, alles
soll für die Ewigkeit sein. Mit dieser Einstellung wird ein Teil der Träume nicht erfüllbar, wird zum
ewigen Traum verdammt.
Viele unserer Träume werden realisierbar, wenn sie weniger mit Ansprüchen belastet sind. Wenn
eine liebevolle Beziehung in dem Moment, in dem sie funktioniert, als gelungen betrachtet wird und
jeder weitere glückliche Tag, jedes weitere glückliche Jahr als Fortführung dieses Gelingens, ohne
den Anspruch auf Unendlichkeit, empfunden wird, dann würde es mit Sicherheit mehr gelungene
Beziehungen geben. Wenn Familien sich von dem Anspruch der richtigen Familie lösen und
Patchwork-Familien oder andere Formen des Zusammenlebens als gleichwertige, ebenso einen
Anspruch auf familiäres Glück habende Gemeinschaften verstanden werden, gäbe es mehr
glückliche Familien. Und wenn Eltern ein Kind unbefangen annehmen, wenn ein Kind
beispielsweise nicht das falsche Geschlecht haben kann, dann wird es mehr Kinder geben, die
selbstbewusst ihren Weg gehen.
In diesen Fällen lässt sich das Zerbrechen von Träumen aufhalten. Träume werden wahr, vielleicht
nicht für immer und nicht in unbegrenzten Dimensionen, aber ein Traum kann ebenso mehrmals in
verschiedenen oder abgewandelten Formen zur Realität werden.
Es gibt jedoch auch Träume, deren Zerbrechen nicht verhindert werden kann – Träume, die durch
das, was allgemein als Schicksal bezeichnet wird, keine Chance bekommen, zur Realität zu
werden. Mein persönlicher Traumbrecher war die Geburt meines zweiten Kindes. Nein, eigentlich
nicht die Geburt, denn dem äußeren Anschein nach vermittelte mein Sohn das Bild eines typischen
Babys.
Mein Traum, in den naturwissenschaftlichen Forschungsalltag zurückzukehren, zerbröselte in den
folgenden Monaten und Jahren. Er wurde ersetzt durch viele Träume von Dingen, die ich bis dahin
als selbstverständlich wahrgenommen hatte: Ich träumte und wünschte, dass mein Kind lernt,
selbstständig zu essen, sich allein an- und auszuziehen, zu sprechen … Ich hoffte jeden Tag, dass
ich im Supermarkt oder auf dem Spielplatz einmal nicht belehrt oder beschimpft werde.
Ich weiß jetzt, wie sich Verzweiflung anfühlt, wie süß winzig kleine Erfolge schmecken, was alles
nicht selbstverständlich ist. Ich weiß auch, dass Träume in Erfüllung gehen können.
Oft wurde ich gefragt, ob ich mir nicht ein anderes Kind wünsche oder warum ich mein besonderes
Kind denn überhaupt liebe.
Warum liebe ich mein besonderes Kind?
Ich liebe es nicht, weil es hübsch lächelt, denn es lächelte mich nicht an.
Ich liebe es nicht, weil es freudig auf mich zugelaufen kommt, denn es lief mir nicht entgegen.
Und ich liebe es nicht, weil es entzückend „Mama“ plappert, denn es redete mich nicht an.
Wo kommt diese tiefe, mitunter auch von Verzweiflung gespeiste Liebe also her? Liebe ist ein
Geben und Nehmen, ohne diese Dinge gegeneinander aufzurechnen. Eine Mutter streichelt ihr
Baby und lächelt, worauf dieses freudig gluckst und ihr die Ärmchen entgegenreckt. Wie funktioniert
aber Liebe, wenn das Gegebene scheinbar nicht entgegengenommen wird? Wenn von der
empfangenden Seite gefühlt nichts zurückkommt? Oder wenn das Zurückkommende so zart,
winzig, zerbrechlich oder anders ist, dass dessen Deutung als Liebe schwerfällt?
Neben meiner Liebe existierte ein weiteres starkes, über eine geraume Zeit unbewusstes Gefühl:
Die innere Gewissheit, dass meine Liebe entgegengenommen wird, auch wenn ich dies an äußeren
Zeichen lange nicht festzumachen vermochte.
Mein besonderes Kind forderte viele Jahre durch Nichtfordern Liebe auf eine andere Art. Eine Art,
die rückblickend meinen nicht-autistischen Kindern sehr zugute kam.

Traumbrecher

© Inez Maus 2014–2026