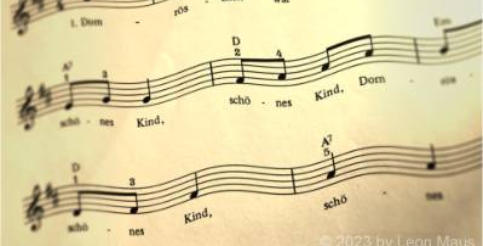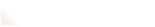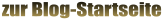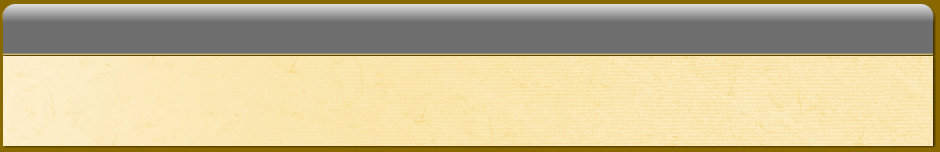


Anguckallergie
Inez Maus
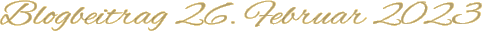
Wo man singt …

© Inez Maus 2014–2025


…, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder.
Oder: Wie viel Schaden können Redewendungen und Sprichwörter anrichten?
Sprichwörter und Redewendungen bestimmen unseren Alltag. Im Repertoire eines erwachsenen Menschen
befinden sich durchschnittlich ca. 300 bis 500 derartige Verbindungen, die mehr oder weniger oft zum Einsatz
kommen. Laut duden.de ist eine Redewendung eine „feste Verbindung von Wörtern, die zusammen eine bestimmte,
meist bildliche Bedeutung haben“, wogegen ein Sprichwort ein „kurzer, einprägsamer Satz [ist], der eine praktische
Lebensweisheit enthält“. Sprichwörter vermitteln Volks- und Lebensweisheiten auf eine einprägsame, oft
metaphorische Art und Weise. Redewendungen, die meist nur aus einzelnen Wörtern bestehen, dienen dazu, etwas
zu erklären, was sonst umständlich umschrieben werden müsste. Wenn man sich beispielsweise wie ein Elefant im
Porzellanladen verhält, dann bedeutet dies, ganz verkürzt gesagt, dass man ungeschickt oder tollpatschig ist.
Die eingangs zitierte Formulierung ist also ein Sprichwort. Dieses Sprichwort vermittelt die Erfahrung, dass singende
Menschen normalerweise keine schlechten Absichten hegen oder böse Gedanken formulieren, denn das
gemeinsame Singen ist eine soziale Aktivität, die verbindet.
Genau genommen ist dieses Sprichwort aber ein geflügeltes Wort. Bei geflügelten Worten, die sowohl Sprichwörter
als auch Redewendungen sein können, ist der Urheber beziehungsweise eine Quelle bekannt. Beispiele hierfür sind
Goethes „des Pudels Kern“ (Faust) oder Schillers „Ich kenne meine Pappenheimer“ (Wallenstein). Das Sprichwort
über das Singen stammt aus einem Volkslied des deutschen Dichters Johann Gottfried Seume.
Im Original lautet es folgendermaßen:
„Wo man singet, laß dich ruhig nieder,
Ohne Furcht, was man im Lande glaubt;
Wo man singet, wird kein Mensch beraubt;
Bösewichter haben keine Lieder.“*
Dieses Sprichwort lässt sich insofern kritisieren, dass es sehr wohl „böse Menschen“ gibt, die Lieder haben –
beispielweise Lieder, die der Propaganda dienen oder die benutzt werden, um in den Krieg zu ziehen. Natürlich ist
es hier immer eine Frage der Perspektive, wer von wem als „böser Mensch“ angesehen wird.
Autistische Menschen haben aufgrund ihres wortwörtlichen Sprachverständnisses häufig Probleme mit bestimmten
sprachlichen Formulierungen. Bereits autistische Kinder fallen durch das mehr oder weniger stark ausgeprägte
Unvermögen auf, Füllwörter, Redewendungen oder Sprichwörter zu verstehen. Später erweitert sich die Liste der
Dinge, die Schwierigkeiten bereiten, um Metaphern, Ironie, Witze und Small Talk.
Erwachsene Menschen mit dem Asperger-Syndrom lernen oft im Laufe ihres Lebens eine gewisse Anzahl an
Sprichwörtern und Redewendungen in ihrer Bedeutung auswendig, um sprachlichen Missverständnissen so aus
dem Weg gehen zu können. Gelegentlich versuchen sie sich aus einem Anpassungsbestreben heraus selbst am
Einsatz dieser Formulierungen, wobei der Erfolg aber nicht immer vorbestimmt ist. Es kann dabei unfreiwillig eine
gewisse sprachliche Komik entstehen, wenn autistische Menschen Redewendungen oder Sprichwörter benutzen, es
ihnen aber nicht gelingt, diese zu rezipieren und dann wortwörtlich wiederzugeben. Mein autistischer Sohn erzählte
mir in seiner Schulzeit beispielsweise von einem Schüler, der laut der Meinung einer Lehrperson später „auf die
schiefe Umlaufbahn gelangen wird“.
Ein weiteres Erlebnis im Zusammenhang mit Sprichwörtern berichtete mir eine erwachsene, spätdiagnostizierte
Autistin, mit der ich mich im Zuge meiner Recherchen zu meinem neuen Buch „Familienbande bei Autismus“
unterhielt. Das eingangs erwähnte Sprichwort löst bis heute unangenehme Gefühle bei ihr aus. Der Grund dafür ist,
dass ihre Mutter sie aufgrund ihrer auditiven Wahrnehmungsempfindlichkeit mit Bezug auf dieses Sprichwort zum
wiederholten Male als „schlechten Menschen“ bezeichnet hatte. Die Mutter hörte fast ständig Schlagersendungen im
Radio und sang die Lieder bei der Hausarbeit lautstark mit. Die Tochter erledigte Hausarbeit ohne Gesang und
Radio. Des Öfteren bat sie die Mutter um etwas Ruhe oder um zumindest weniger Lautstärke. Diese Bitten wurden
nicht nur stets mit dem Hinweis auf obiges Sprichwort abgelehnt, sondern auch mit der Aufforderung ergänzt, die
Tochter solle ihr Verhalten ändern und sich endlich „sozialer verhalten“, damit sie kein schlechter Mensch mehr sei.
Mit ihrem heutigen Wissen über Autismus kann meine Gesprächspartnerin die Erlebnisse gut einsortieren und
trotzdem bleiben sie – wie bereits erwähnt – in der Erinnerung stark haften. Unklar ist die Motivation der Mutter für
ihr Handeln: Wollte sie die Tochter wirklich auf einen guten Weg bringen? War sie nicht bereit, über ihr eigenes
Verhalten nachzudenken? Oder konnte sie sich wirklich nicht vorstellen, dass lautes Singen und Radiohören –
Dinge, die ihr Freude bereiten – für andere Menschen zur Belastung werden können?
Sicherlich gibt es viele spätdiagnostizierte autistische Menschen, die in ihrem Leben ähnliche Erlebnisse hatten.
Viele dieser Handlungen geschehen aus Unwissenheit, aber einige auch aus dem immer noch allgegenwärtig
vorzufindenden Bestreben, autistische Menschen der Gesellschaft anpassen zu wollen, anstatt die Gesellschaft so
zu gestalten, dass autistische Menschen sich ohne oder mit wenig Anpassung darin zurechtfinden oder sogar
wohlfühlen können. Einen ersten Schritt zum Wohlfühlen können nicht-autistische Menschen tun, indem sie
sensibler mit Sprichwörtern und Redewendungen umgehen, wenn sie mit autistischen Menschen interagieren.
* Maria Grazia Chiaro, Werner Scholze-Stubenrecht (2002). Duden, Zitate und Aussprüche. In: Dudenredaktion (Herausgeber), Der
Duden in 12 Bänden. (2., neubearbeitete und aktualisierte Auflage) (S. 623), Dudenverlag: Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich.