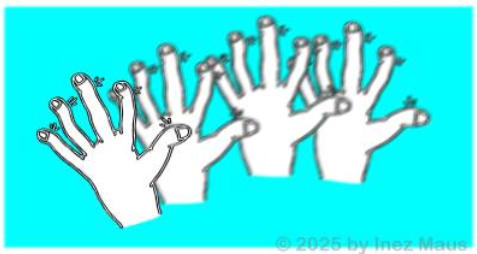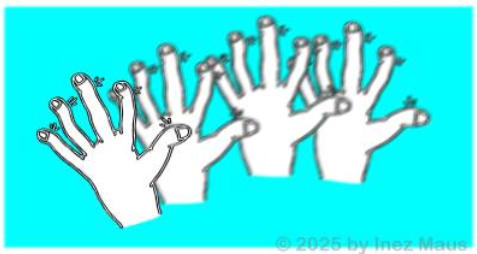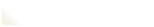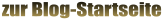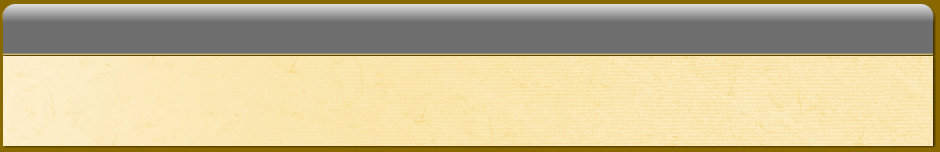


Anguckallergie
Inez Maus
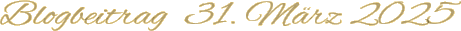
Die Rolle von Misokinesie bei der Gewaltprävention

© Inez Maus 2014–2025


Gewaltprävention ist beziehungsweise sollte ein wichtiges Thema in allen Einrichtungen sein, die Menschen mit
Behinderungen bei der Bewältigung ihrer behinderungsspezifischen Schwierigkeiten unterstützen. Dies sind neben
Bildungseinrichtungen unterschiedlicher Art auch Angebote zum Wohnen und Arbeiten.
Laut Duden (duden.de, 30.03.202) bedeutet Gewalt:
•
Macht, Befugnis, das Recht und die Mittel, über jemanden, etwas zu bestimmen, zu herrschen
•
unrechtmäßiges Vorgehen, wodurch jemand zu etwas gezwungen wird
•
gegen jemanden, etwas [rücksichtslos] angewendete physische oder psychische Kraft, mit der etwas erreicht
werden soll.
Als Beispiele für Gewalt nannten autistische Menschen mir gegenüber das Fehlen von Respekt, ungewollte
Körperkontakte, mangelnde Mitbestimmung, keine Möglichkeit zum Treffen von Entscheidungen und das Ignorieren
von Konflikten mit Personen, die sich in der gleichen Situation befinden. Sehr interessant im Sinn von des
Nachdenkens wert fand ich die als Antwort gegebene Gegenfrage: „Ist Ungeduld der Beginn von Gewalt?“
Faktoren, die das Entstehen von Gewalt begünstigen, sind neben einem Mangel an Fachkräften und einem
bestehenden Machtgefälle eine unzureichende Einarbeitung und die fehlende Weiterbildung von Personen, die in
den entsprechenden Einrichtungen arbeiten. Gewaltschutzkonzepte sollen durch Aufklärung über
Entstehungsmechanismen und Anleitung zum Handeln für das Thema Gewalt sensibilisieren und dazu führen, dass
Gewalt als solche erkannt und abgebaut wird oder im besten Fall erst gar nicht entsteht.
Ein weiterer Faktor, der das Entstehen von Gewalt speziell im Kontext von Autismus begünstigen kann, ist ein
Vorhandensein von Misokinesie. Misokinesie bedeutet wörtlich übersetzt der Hass auf Bewegungen.
Personen, die sich als misokinetisch bezeichnen (es geht hier um die Allgemeinbevölkerung), weisen eine
Abneigung auf gegen sich wiederholende Körperbewegungen anderer Personen. Dies kann beispielsweise ein Auf-
und Abgehen oder das Zappeln sein. Laut neueren Studien kommt Misokinesie fast bei jedem dritten Menschen in
unterschiedlich starker Ausprägung vor (neuroscience.com, 2024 12 09).
Autismus geht oft einher mit wiederholten Körperbewegungen. Das kann beispielsweise das Wedeln mit den
Händen, ein Drehen im Kreis, rhythmisches Klatschen, das Klopfen auf Gegenstände oder Wände und das
wiederholte Zupfen von Haut oder Kleidung sein. All diese repetitiven Handlungen in Form von motorischen
Stereotypien erfüllen in der Regel eine Funktion. Sie dienen unter anderem der Beruhigung, dem Abbau von Stress
oder Angst, der Verarbeitung von zu vielen eintreffenden Reizen, dem Überbrücken von Langeweile oder der
Kundgabe von unbefriedigten Bedürfnissen.
Wenn betreuende Personen mit Misokinesie mit derartigen Verhaltensweisen konfrontiert werden, dann zeigen sie
unterschiedliche körperliche Symptome, die je nach Schweregrad von Konzentrationsschwierigkeiten über
Wutgefühle bis zu Herzklopfen reichen können. Damit entsteht eine Situation, die das Ausführen von Handlungen,
die als Gewalt eingestuft werden, begünstigen.
Als mögliche Ursache für Misokinesie werden Spiegelneuronen diskutiert. Spiegelneuronen sind spezielle
Nervenzellen im Gehirn, die bei Beobachtung von Bewegungen das gleiche Aktivitätsmuster zeigen, als würde die
Person die Bewegung selbst ausführen. Diese Aktivierung bestimmter Hirnbereiche kann dazu führen, dass
betreuende Personen mit Misokinesie gestresst, ungeduldig oder genervt auf das repetitive Verhalten des
autistischen Menschen reagieren und somit schnell eine Spirale entsteht, bei der sich die Verhaltensweisen der
beteiligten Personen weiter verschärfen.
Um Eskalationen in solch schwierigen Situationen zu vermeiden, ist es zuerst einmal wichtig, dass betreuende
Personen mit Misokinesie diesen Mechanismus bei sich selbst erkennen und verstehen. Damit ist es ihnen möglich,
die damit verbundenen unangenehmen Emotionen zu verstehen und diese nicht auf den autistischen Menschen zu
projizieren. Des Weiteren ist es ihnen möglich herauszufinden, was ihnen in solch einer Situation hilft. Im Umgang
mit der eigenen Misokinesie kann es hilfreich sein, Alternativreaktionen zu erlernen, wie beispielsweise den Blick
abzuwenden, ein funktionierendes Beruhigungsritual ausführen oder kurzzeitig mit einer anderen Person zu
tauschen. Für Menschen, die ihre Misokinesie als erhebliche Einschränkung im Berufs- und Privatleben empfinden,
kommt eine akzeptanzbasierte kognitive Verhaltenstherapie infrage.