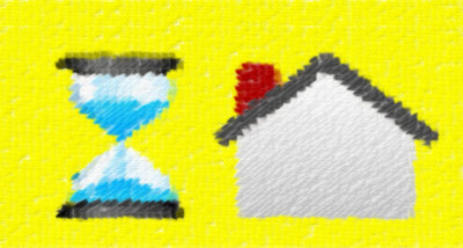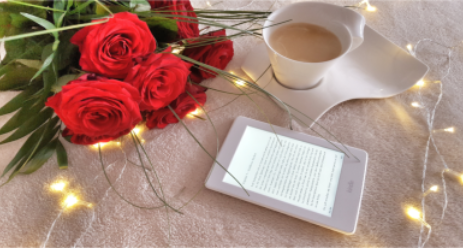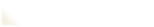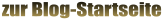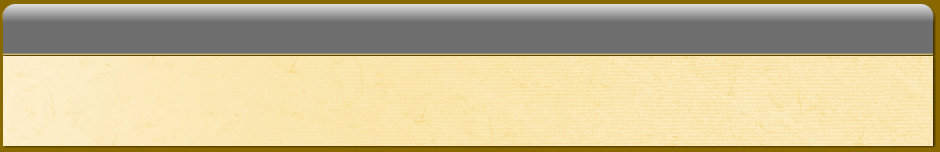


Anguckallergie
Inez Maus
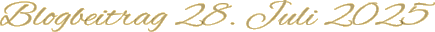
Buchvorstellung „Happiness Falls“

© Inez Maus 2014–2025


Das Buch „Happiness Falls“ aus dem Verlag hanserblau ist mir sprichwörtlich über den Weg gelaufen, als ich
Lesestoff für meinen Urlaub an der Ostsee gesucht habe. Um Gepäck zu sparen, habe ich nur E-Books
mitgenommen und dementsprechend bezieht sich meine Buchvorstellung auf diese Ausgabe des Buches.
Der Roman „Happiness Falls“ handelt von Ereignissen in einer gegenwärtigen amerikanischen Familie, die –
bestehend aus den Eltern und drei Kindern – einige Besonderheiten aufweist:
•
Mutter und Vater haben vier Jahre zuvor die Rollen getauscht, sodass der Vater nun Hausmann ist.
•
Die älteren Kinder – Mia und John – sind Zwillinge, zwanzig Jahre alt.
•
Der sechs Jahre jüngere Junge ist behindert – er ist nonverbaler Autist und hat zusätzlich eine leichte Form des
Angelmann-Syndroms.
•
Die Mutter stammt aus Korea und ist als Jugendliche in die Staaten gekommen.
Diese nicht typische amerikanische Familie wird eines Tages mit dem Verschwinden des Vaters und Ehemannes
konfrontiert. Erzählt werden die Ereignisse im Rückblick aus der Sicht von Mia. Als Leser weiß man nicht genau, ob
das Buch ein Thriller, ein Drama, eine Gesellschaftsstudie oder ein Krimi ist, aber das tut dem Lesegenuss keinen
Abbruch – wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen.
Apropos Lesegenuss: Genuss ist hier eigentlich nicht das passende Wort, den zumindest Familien, die ein ähnlich
behindertes Kind haben und die auch mit der dazugehörigen Geschwisterproblematik vertraut sind, werden das
Buch eher lesen, weil sie sich in Teilen mit ihren Problemen dort wiederfinden oder sogar Anregungen erhalten
können, zum Beispiel durch die teilweise kreativen Lösungen aus dem Alltag der Romanfamilie wie Zahnputzrituale.
Aufgrund der Tatsache, dass Angie Kim ihre erfundene Familie in den Kontext vieler weiterer Probleme stellt, kann
von Lesegenuss ebenfalls nicht die Rede sein – eher von Spannung. All diese Problemfelder, die die Autorin
sukzessive anspricht, fügen sich nahtlos in die Geschichte ein und wirken nicht aufgesetzt nach dem Motto „Was
könnte denn noch Schlimmes passieren?“ Die wichtigsten dieser Problemfelder sind Folgende:
•
Die Haupthandlung ereignet sich in den ersten Monaten der Pandemie – mit allem, was dazugehört wie Angst vor
Ansteckung, das Tragen von Masken, Testflicht, Homeoffice …
•
Die unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten der Familienmitglieder bescheren diesen immer wieder
seltsame und unschöne Erlebnisse – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
•
Da der autistische Sohn beim Verschwinden des Vaters in einen Autounfall verwickelt wird, stellt sich rasch die
Frage, ob die Aufsichtspflicht vernachlässigt wurde – also ob der Junge in Obhut genommen werden muss. Eine
Angst, die viele Familien mit behinderten Kindern kennen. Noch schwieriger wird die Situation durch die
drohende Inhaftierung des behinderten Kindes.
•
Ein sehr zentrales Thema des Romans sind die ambivalenten Gefühle der älteren beiden Geschwister – ihr
Schwanken zwischen Liebe und Verständnis auf der einen Seite und Wut, Verzweiflung, Hass sowie daraus
resultierend Scham auf der anderen Seite.
Diesen Aspekt des Romans empfand ich besonders lebendig, weil ich an vielen Stellen plötzlich das Gefühl hatte,
nicht einen Roman zu lesen, sondern in einem meiner Geschwisterabende (Kurse für Geschwister von autistischen
Kindern, organisiert vom Bundesverband autismus Deutschland e. V.) zu sein und den Geschwisterkindern
zuzuhören. Die Ambivalenz der Gefühle von Geschwisterkindern zeigt sich bereits am Beginn des Buches, als die
Protagonistin Mia nicht bemerkt, dass ihr Vater nicht wie erwartet um die Mittagszeit nach Hause gekommen ist. Sie
bemerkt es nicht, weil sie den Paketboten, der den Kiesweg entlanggeht, für den heimkehrenden Vater hält, der sie
gemäß ihrer aus früheren Erlebnissen gespeisten Erwartung nicht beachtet, sondern sich um den autistischen Sohn
kümmert, obwohl der Vater doch zu den Menschen gehört, die „mich eigentlich lieben sollten“. Weil sie sich in ihrer
„selbstgerechten Empörung“ suhlt, verzögert sich der Beginn der Suche nach dem vermissten Vater um Stunden.
Später quälen sie Schuldgefühle.
An anderer Stelle erfährt der Leser, dass die Zwillinge – in Anbetracht einer einige Jahre zuvor drohenden Scheidung
der Eltern – sofort Pläne zum Babysitten des autistischen Bruders und zum Schenken von Gutscheinen für
romantische Aktionen der Eltern schmiedeten, weil sie auf keinen Fall wollten, dass die Familie zerbricht – die
Familie mit dem autistischen Bruder!
Ähnlich ambivalent wie die Geschwisterbeziehungen gestalten sich im Verlauf der Handlungen die Einstellung und
die Gedanken der Zwillinge – insbesondere die von Mia – in Bezug auf ihren verschwundenen Vater. Für sein
Verschwinden gibt es viele Möglichkeiten: Mord, Unfall, Entführung, freiwilliges Untertauchen … Ist der Vater ein
schlechter Vater, wenn er wirklich mit einer anderen Frau durchgebrannt sein sollte? Darf man ihn dafür hassen?
Oder entwickeln die Zwillinge, die selbst schon eigene Beziehungserfahrungen haben, in diesem Fall – wenn es die
Lösung des Rätsels sein sollte – Verständnis für den Vater?
Die Beispiele verdeutlichen die Komplexität und Vielfältigkeit des Romans. Es ist sicherlich nicht die schnell zu
lesende, leichte Sommerlektüre, aber für Personen, die einen spannenden und tiefgründigen Roman mit viel Stoff
zum Nachdenken suchen, die empfehlenswerte Lektüre.
Ein paar Wermutstropfen gibt es allerdings in der deutschen Fassung. Die Übersetzerin Wibke Kuhn und das
Lektorat des Verlags haben mit Halbgeviertstrichen äußerst gegeizt, sodass einige von Angie Kims verschachtelten
Sätzen erst beim zweiten Lesen ihren wahren Sinn preisgeben. Einige Phrasen sind unglücklich ins Deutsche
übersetzt und ergeben an einigen Stellen keinen Sinn. Und schlussendlich sind doch einige Rechtschreib- und
Grammatikfehler im Buch zu finden, die zum Ende hin zunehmen und den Lesefluss stören.
Angie Kim verwendet in ihren Roman Fußnoten und lässt ihre Protagonistin Mia erklären, dass man diese überlesen
könne, wenn es einen nicht interessiert. Es erschließt sich mir als Leser allerdings nicht, nach welchem Prinzip
Begebenheiten im Text oder in den Fußnoten untergebracht wurden.
Das Buch schließt mit „Anmerkungen der Autorin“. Hier erfährt man, dass die Autorin aus Korea stammt und als Kind
in die USA kam. Weiterhin erfährt man, dass sie drei Söhne hat und einer von ihnen an Colitis ulcerosa erkrankt ist –
sie ist somit persönlich mit den Problemen von Geschwisterkindern vertraut, was vielleicht dazu beigetragen hat,
dass ihre Beschreibungen der Geschwisterdynamiken auf mich so authentisch wirkten. Angie Kim unterrichtet zudem
eine „Gruppe von Buchstabierern“ in kreativem Schreiben, womit sie nonverbale Menschen mit verschiedenen
Behinderungen meint, die mithilfe von Buchstabentafeln kommunizieren. In den Anmerkungen finden sich ebenfalls
hilfreiche Links zum Angelmann-Syndrom, zu verschiedenen Methoden des Buchstabierens und zu Werken von
„Buchstabierern“. Links zum Thema Autismus finden sich dort nicht. Publikationen, die die Protagonisten im Roman
erwähnen, werden im Anhang ebenfalls benannt, was sicher für all diejenigen hilfreich ist, die noch tiefer in Themen
des Buches einsteigen möchten.