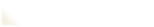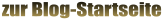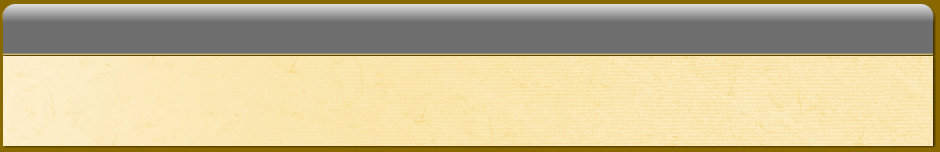


Anguckallergie
Inez Maus
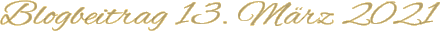
„Mein Lieblingsautist“

© Inez Maus 2014–2025


Vor ein paar Tagen hörte ich sie zum wiederholten Male. Sie – die Formulierung, bei der sich mir die Nackenhaare
sträuben.
„Mein Lieblingsautist …“, begann eine Fachperson zu berichten. Mir fällt es dann immer schwer weiter zuzuhören,
denn ich beginne sofort zu grübeln, was ein oder der „Lieblingsautist“ ist. Bisher habe ich diese Formulierung nur von
pädagogischen Fachpersonen gehört. Diese Personengruppe sollte aber keine Lieblinge haben – nicht unter den
nicht-autistischen Kindern und nicht unter den autistischen Kindern. Natürlich weiß ich, dass wir alle nur Menschen
sind und dass wir uns unserer Gefühle nicht immer ganz erwehren können. Dann sollte man aber wenigstens im
öffentlichen Raum diese Gefühle nicht kundtun.
Die anderen Möglichkeiten, die sich hinter der Formulierung „Lieblingsautist“ verbergen könnten, sind zum einen ein
autistisches Kind, welches wenige Probleme im Alltag bereitet, oder zum anderen ein solches Kind, welches
Auffälligkeiten zeigt, die sich besonders gut dazu eignen, um an das Publikum weitergegeben zu werden, weil sie
besonders große Effekte erzielen.
Soweit ich weiß, hat nie jemand meinen autistischen Sohn als seinen Lieblingsautisten bezeichnet. Mein Kind war an
der Förderschule nie der Lieblingsautist, denn dort gab er sich „zu wenig Mühe“. An der Regelschule nahm er diese
Rolle nicht ein, weil es dort keinen weiteren autistischen Schüler gab. Oft bekam ich aber zu hören, mein Sohn sei
„außergewöhnlich“ oder „sehr interessant“. Da dies in der Regel in medizinischen oder therapeutischen Kontexten
geschah, sollte in derartigen Situationen damit eher die pathologische Seite zum Ausdruck gebracht werden.
Es gibt auch Fachpersonen, die ihre Beziehung zum Thema Autismus auf gewisse Weise romantisieren. Da wird
davon geredet, dass die eigene Beschäftigung mit dem Thema Autismus bereits volljährig ist. Oder dass man mit
dem Thema Autismus verheiratet sei und schon die Silberhochzeit gefeiert habe. Die schön formulierten Hinweise
auf die eigene Fachlichkeit können bei Angehörigen allerdings ganz andere Gefühle auslösen.
Wenn ich solche Formulierungen höre, dann denke ich sofort an die Familien, die sich die Volljährigkeit ihres
autistischen Kindes anders vorgestellt hatten. Die sich am 18. Geburtstag ihres Kindes Sorgen darüber machen
wollten, in welchem Nachtklub das nun erwachsene Kind den neuen Lebensabschnitt beginnen wird. Die nicht
darüber nachdenken wollten, wie und wo sie ihr Kind gut unterbringen können, wer die Belange ihres Kindes in
Zukunft regeln wird …
Wenn ich solche Formulierungen höre, denke ich ebenfalls an die Familien, die als Familie nicht mehr bestehen. Die
ihre Silberhochzeit nicht feiern werden, weil die Ehe zerbrochen ist. Und die zumindest glauben, die
außerordentlichen Belastungen durch das autistische Kind hätten der Ehe keine Chance zum Bestehen eingeräumt.
Einige Fachpersonen bemühen sich, durch die „autistische Brille“ zu schauen. Das klingt für mich wie ein
Spiegelkabinett. Man geht hinein und sieht, welche Gestalt man als dicker, dünner, großer, kleiner … Mensch
annehmen würde. Man sieht es – das eigene Spiegelbild wird verzerrt, aber man fühlt nicht, wie es ist, der jeweilige
Mensch zu sein.
Warum kann das eigene Bemühen nicht in einfache Worte gefasst werden? Beispielsweise so: Ich versuche,
autistische Menschen zu verstehen, ich höre ihnen zu, ich beschäftige mich seit x Jahren mit dem Thema. Nicht nur
Autistinnen und Autisten könnten mit solchen Formulierungen mehr anfangen als mit „Lieblingsautisten“, mit
„Autismus verheirateten“ Personen oder mit „autistischen Brillen“. Auch Angehörige würden dann von dem
sprichwörtlichen dicken Fell (welches die Fähigkeit beschreibt, gelassen auf widrige Umstände, unangemessene
Kritik oder auch Rückschläge zu reagieren) weniger benötigen.
Zum Weiterlesen:
Betroffene – Ich bin nicht betroffen