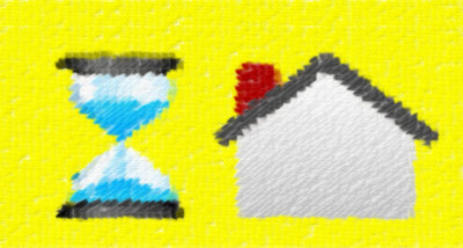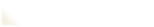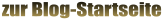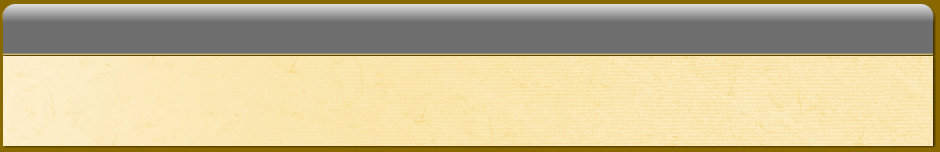


Anguckallergie
Inez Maus
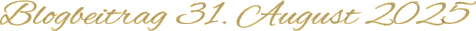
Autismus - vor 25 Jahren und heute (Teil 1/3)

© Inez Maus 2014–2025


Vor Kurzem wurde ich bei einem Interview gefragt, welche Dinge in Bezug auf Autismus sich in den vergangenen 25
Jahren geändert haben. Da eine einzige Interviewfrage für ein solch komplexes Thema nicht ausreicht und die
ungesagten Dinge seitdem in meinem Kopf umherirren, habe ich beschlossen, sie mit meinen Leserinnen und
Lesern zu teilen.
Um die Jahrtausendwende wurde die Autismus-Landschaft von Fachpersonen dominiert. Deren Blick auf das Thema
war stark defizitorientiert, obwohl mit der Aufnahme des Asperger-Syndroms in die ICD-10 (1990 verabschiedet,
1994 eingeführt) die Defizitorientierung eine Relativierung erfuhr, da diese Menschen ihre Stärken präsentieren
konnten und auch begannen, dies zu tun. Auf Tagungen zum Thema Autismus war es üblich, Eltern autistischer
Kinder als „schmückendes Beiwerk“ zu Wort kommen zu lassen. Einige Jahre nach Beginn des neuen Jahrtausends
wurde diese Rolle zunehmend autistischen Menschen übertragen.
Zur Defizitorientierung gehörte auch, dass sich die Fachwelt einig darüber war, dass autistische Kinder nicht kreativ
sein können: „Die intelligenteren Kinder mit Autismus haben wenig Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Aber auch
wenn sie meist richtig konstruierte Sätze schreiben können, sind sie deshalb nicht kreativ. […] die Inhalte sind
lediglich exzentrisch, bizarr und repetitiv“ (Aarons & Gittens, 2007, S. 118). Zahlreiche autistische Künstler haben in
den vergangenen Jahren derartige Feststellungen auch in anderen Bereichen der Kunst widerlegt.
Aufgrund der eben erwähnten Defizitorientierung waren Fachpersonen, die Diagnostik durchführten, sehr vorsichtig
mit der Vergabe der Diagnose Autismus. Vor ungefähr fünfzehn Jahren sagte eine Psychiaterin einmal zu mir:
„Früher haben wir dreimal überlegt, bevor wir die Diagnose vergeben haben, heute kommen die Eltern mit der
Diagnose zu uns, weil sie im Internet ein paar Tests gemacht haben.“ Die Zunahme der Häufigkeit von Autismus, die
zu einem großen Teil den geänderten Diagnosekriterien zuzuschreiben ist, hat dazu geführt, dass Autismus häufig
als „Modediagnose“ bezeichnet wird (wobei hier der Blick auf Personen gerichtet ist, die den Kriterien des
ehemaligen Asperger-Syndroms entsprechen) und dass die damit einhergehenden Probleme nicht ernst genommen
werden.
Informationen über Autismus zu erlangen, war vor 25 Jahren relativ schwierig. Das Internet steckte in den
sprichwörtlichen Kinderschuhen und wenn es wirklich eine Seite gab, die sich mit Autismus beschäftigte, war nach
dem Öffnen des entsprechenden Links häufig zu lesen: „Diese Seite befindet sich im Aufbau.“ Podcasts, YouTube-
Videos und Blogs waren noch nicht zum Leben erweckt. Der Buchmarkt lieferte einige Fach- und Sachbücher zum
Thema. Sachbücher waren häufig aus dem Amerikanischen übersetzte Biografien von Müttern, die es geschafft
hatten, ihre autistischen Kinder auf spektakuläre Art zu heilen (/s). Eins der wenigen Sachbücher, das aus diesem
Muster herausfiel, war die schon einige Jahre zuvor erschienene Autobiografie von Temple Grandin. Dieses Buch mit
populärwissenschaftlichem Anspruch, welches auch heute noch absolut lesenswert ist, widerlegte, dass „der
autistische Geist […] unfähig [ist], sich selbst und andere zu verstehen, und folglich unfähig zu authentischer
Introspektion und reflektierender Rückschau“ (Sacks, 2002, S. 350). Damit war der Weg gebahnt, um Autismus nicht
nur aus der Sicht von Fachpersonen oder Eltern, sondern auch und vor allem aus der Perspektive von autistischen
Menschen zu betrachten und zu verstehen.
Diese Perspektive von autistischen Menschen hat dazu geführt, dass Autismus heute nicht mehr als Krankheit mit
einem Heilungsanspruch betrachtet wird, sondern als neurologische Besonderheit, die ein angepasstes Umfeld und
therapeutische Unterstützung zur Alltagsbewältigung benötigt.
Heute existiert eine nahezu unüberschaubare Fülle an Informationsquellen, wenn man etwas zum Thema Autismus
wissen möchte. Nicht alle sind seriös und manchmal fällt es auch Fachpersonen schwer, die sprichwörtliche Spreu
vom Weizen zu trennen. Autistische Protagonisten finden sich in belletristischen Werken, in Filmen und in Serien.
Befragt man autistische Menschen, empfinden sie diese Darstellungen oft als einseitig oder klischeehaft.
Je mehr ich über dieses Thema schreibe, desto mehr fällt mir ein, was noch betrachtet werden sollte. Um den
Beitrag nicht zu lang werden zu lassen, beende ich ihn an dieser Stelle und werde die Ausführungen im September
fortsetzen.
Den Teil 2 finden Sie hier.