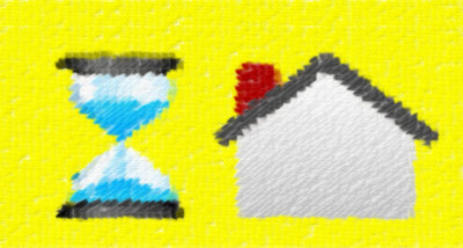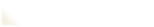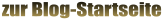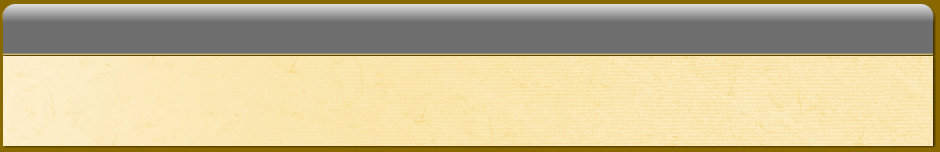


Anguckallergie
Inez Maus
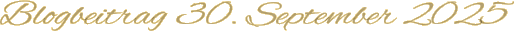
Autismus - vor 25 Jahren und heute (Teil 2/3)

© Inez Maus 2014–2025


Vor Kurzem wurde ich bei einem Interview gefragt, welche Dinge in Bezug auf Autismus sich in den vergangenen 25
Jahren geändert haben. Da eine einzige Interviewfrage für ein solch komplexes Thema nicht ausreicht und die
ungesagten Dinge seitdem in meinem Kopf umherirren, habe ich beschlossen, sie mit meinen Leserinnen und
Lesern zu teilen.
Hier folgt nun der Teil 2, den vorangegangenen Blogbeitrag finden Sie hier.
Im letzten Beitrag erwähnte ich bereits die Einführung des Asperger-Syndroms als eigenständige Diagnose. Dem
vorausgegangen war das Bekanntwerden von Hans Aspergers Habilitationsschrift aus dem Jahr 1944. Dies ist der
britischen Psychiaterin Lorna Wing zu verdanken, die bereits 1981 eine Zusammenfassung der Habilitationsschrift
Aspergers veröffentlichte und damit dafür sorgte, dass Aspergers Arbeit über den deutschen Sprachraum hinaus
wahrgenommen wurde.
Hans Asperger wurde nach Einführung der eigenständigen Diagnose Asperger-Syndrom, die von Lorna Wing zu
Ehren Hans Aspergers vorgeschlagen worden war, posthum sehr bekannt und teilweise beinahe als Held verehrt,
weil er mit seiner Arbeit die von ihm als „autistische Psychopathen im Kindesalter“ bezeichneten Kinder (mit weniger
starker Beeinträchtigung) vor den „rassenhygienischen Säuberungen“ während der NS-Zeit schützte, indem er
diesen Kindern einen späteren Wert als Arbeitskräfte zuschrieb. An Aspergers Arbeitsort in Wien wurden von 1940
bis 1944 in der sogenannten Kinderfachabteilung Am Spiegelgrund mehr als 800 behinderte und verhaltensauffällige
Kinder grausam getötet, weil sie nach nationalsozialistischer Ideologie für die Gesellschaft keinen Wert hatten. Seit
dem Jahr 2003 erinnern 802 Leuchtstäbe mit eingravierten Namen an die ausgelöschten Leben. Inzwischen muss
Aspergers Rolle im historischen Geschehen deutlich differenzierter betrachtet werden, denn der österreichische
Medizinhistoriker Herwig Czech hat mittlerweile dokumentiert, dass Asperger sich an das System anpasste und dass
er schwer behinderte Kinder an die Kinderfachabteilung Am Spiegelgrund überwies, von der er wusste, welches
Schicksal die Kinder dort erwartete.
Lorna Wing, die selbst Mutter einer autistischen Tochter war, formulierte bereits in den 1980er-Jahren den Autismus-
Spektrum-Gedanken, da sie davon überzeugt war, dass alle Formen des Autismus fließend ineinander übergehen.
Mit ihrem Vorschlag, das Asperger-Syndrom als eigenständige Diagnose einzuführen, verzögerte sie allerdings
ungewollt die Verbreitung der Auffassung vom Autismus-Spektrum. Später bezeichnete sie ihren Vorschlag der
Einführung des Asperger-Syndroms deshalb als Büchse der Pandora. Seit dem Jahr 2013 hat es die Auffassung vom
Autismus-Spektrum in die Diagnosekriterien für Autismus geschafft, denn im DSM-5 gibt es lediglich die Diagnose
Autismus-Spektrum-Störung in unterschiedlich starker Ausprägung. Dem schließt sich auch die 2022 in Kraft
getretene ICD-11 an.
Besonderheiten der Wahrnehmung sind bei Autismus sehr häufig zu finden. Obwohl sie bis zu den Neuerungen des
DSM-5 und der ICD-11 keine Rolle in der Diagnostik spielten, waren sie in Fragebögen von Autismus-Ambulanzen
und ähnlichen Einrichtungen, die einen Hinweis auf das Vorliegen von Autismus bei Kindern geben sollten, schon
immer deutlich vertreten. Um die Jahrtausendwende wurde das Bild des autistischen Menschen, der seine Hand auf
die heiße Herdlatte legt und dabei keinen Schmerz empfindet, allmählich abgelöst vom Bild des autistischen
Menschen, der extrem geräuschempfindlich ist und deshalb ständig Kopfhörer trägt. Beide Darstellungen werden der
Komplexität des Themas nicht gerecht.
Nicht nur die Diagnosekriterien haben sich in den vergangenen 25 Jahren geändert, auch die Auffassungen zu den
Komorbiditäten unterliegen – wissenschaftlichen Untersuchungen geschuldet – dem Wandel. Lange Zeit galten
beispielsweise Autismus und ADHS als sich gegenseitig ausschließende Diagnosen, bis im Jahr 2008 eine Studie
des Institute of Psychiatry am King's College in London dies widerlegte. Heute ist ADHS die bei Autismus am
häufigsten diagnostizierte Komorbidität.
Da sich einzelne Symptome über mehrere Störungen erstrecken – nicht nur bei Autismus und ADHS – fragen einige
Forscher inzwischen, ob die heutigen diagnostischen Kategorien noch zeitgemäß sind. Ein Modell, welches sich
vielleicht in 25 Jahren verbreitet haben wird, sieht vor, nur noch externalisierende Störungen (die Reaktion einer
Person auf seine Umwelt ist gestört) und internalisierende Störungen (die Hauptsymptome beeinträchtigen den
inneren Zustand einer Person) zu unterscheiden. Wo fände sich in diesem Modell Autismus?
Auch wenn mein letzter Satz wie ein schönes Schlusswort klingt, gibt es zu dem Thema dieses Blogartikels noch
immer einige wichtige Dinge zu schreiben, zum Beispiel dazu, was sich durch Inkrafttreten der UN-BRK bezüglich
Autismus geändert hat. Daher werde ich diese Reihe fortsetzen.
Den Teil 3 finden Sie hier.