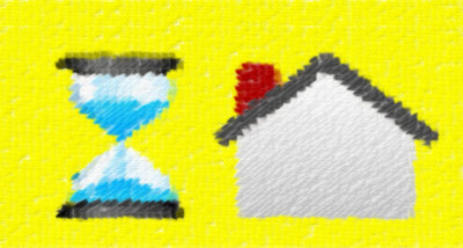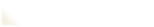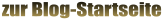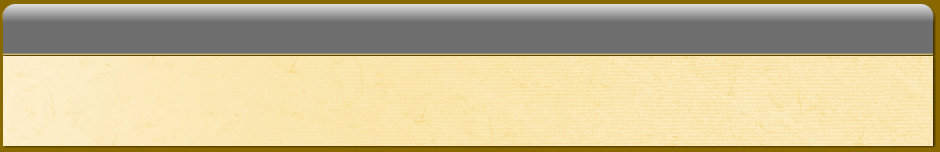


Anguckallergie
Inez Maus
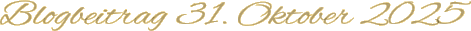
Autismus - vor 25 Jahren und heute (Teil 3/3)

© Inez Maus 2014–2025


Vor Kurzem wurde ich bei einem Interview gefragt, welche Dinge in Bezug auf Autismus sich in den vergangenen 25
Jahren geändert haben. Da eine einzige Interviewfrage für ein solch komplexes Thema nicht ausreicht und die
ungesagten Dinge seitdem in meinem Kopf umherirren, habe ich beschlossen, sie mit meinen Leserinnen und
Lesern zu teilen.
Hier folgt nun der Teil 3, den ersten Blogbeitrag finden Sie hier.
Mein Blogartikel im September endete mit der Ankündigung, das Thema Autismus – vor 25 Jahren und heute
fortzusetzen und unter anderem das Inkrafttreten der UN-BRK in den Blick zu nehmen.
Gerade gestern hatte ich dazu ein interessantes Erlebnis. Auf einer Veranstaltung zum Projekt „Unseen Lives“ der
Kulturregen Berlin gUG – Netzwerk für inklusives kulturelles Empowerment trafen Menschen ohne und mit (nicht
sichtbarer) Behinderung aufeinander. Eine junge, nicht behinderte Frau, die in ihrer Funktion als Sprecherin eines
der Hörstücke zu Gast war, berichtete von ihrer Schulzeit an einer inklusiven Schule. Als Kind habe sie nur die
Kinder mit sichtbarer Behinderung wahrgenommen und die beiden Schulbegleitungen hätten sich auch nur um diese
Kinder gekümmert. Aus ihrer heutigen Sicht gab es aber in ihrer Klasse noch mehrere Kinder mit unsichtbaren
Einschränkungen, die keine Unterstützung erfuhren und als Störenfriede wahrgenommen wurden. Dazu gab es
sofort zwei weitere Wortmeldungen, wovon die eine beschrieb, dass „autistische Kinder über Tische und Bänke
gehen“ und die andere über das Aufgeben eines Sonderpädagogik-Studiums berichtete, weil angehende Lehrkräfte
kaum Unterstützung erfahren. Diese Einzelaussagen scheinen mir in weiten Teilen den aktuellen Stand der Inklusion
widerzuspiegeln.
Vor 25 Jahren gab es die UN- Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) noch nicht. Die UN-BRK ist ein
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist dabei das Instrument, um Teilhabe
als unveräußerliches Menschenrecht zu verwirklichen. In der Praxis bedeutet Inklusion, dass Menschen mit
Behinderungen sich nicht an Gegebenheiten oder Strukturen anpassen müssen, um ihr Leben nach ihren
Vorstellungen zu gestalten, dass sie die Freiheit haben, eigene Entscheidungen zu treffen, und dass sie
angemessene Unterstützung erhalten, um ihre Ziele erreichen zu können. Im schulischen Bereich bedeutet Inklusion
beispielsweise, dass Kinder mit einer Behinderung das Recht haben, eine Regelschule zu besuchen, und dass das
schulische Umfeld dementsprechend gestaltet wird.
Das war nicht immer so. Vor dem Inkrafttreten der UN-BRK wurde die Entscheidung über die Beschulung vom
Landesschulamt auf Grundlage der Empfehlungen eines Förderausschusses getroffen. In einem Förderausschuss
sollte der sonderpädagogische Förderbedarf des Kindes ermittelt werden, um dann eine passende Förderschule für
dieses Kind festzulegen. Eine Integration von Kindern mit Behinderung an einer Regelschule war die Ausnahme –
und wenn es sich um ein autistisches Kind handelte, war es die Ausnahme von der Ausnahme. Eltern hatten kein
Mitspracherecht und somit mussten auch wir uns der Tatsache beugen, dass die Schullaufbahn unseres autistischen
Kindes an einer Förderschule begann. Dazu kam noch die Bürokratie des Prozederes, die Eltern schmerzliche
Erfahrungen bescherte:
Bis zu Benjamins Aufnahme in die Vorklasse [der Förderschule] kannten wir keine anderen Eltern mit behinderten
Kindern, die uns über solche Dinge wie Förderausschüsse hätten aufklären können. Wir vergaßen sogar, unseren
Sohn in der Grundschule unseres Einzugsbereiches […] anzumelden, weil wir uns dessen nicht bewusst waren, da
Benjamin doch bereits eine Schule besuchte und dort auch eingeschult werden sollte. Dies war vor ein paar
Monaten und erst ein Anruf aus der Grundschule machte uns unser Versäumnis noch rechtzeitig klar. Unseren Sohn
in einer Grundschule anzumelden, um ihn dann gleich wieder abzumelden, weil er diese nicht besuchen konnte, das
war ein äußerst bitterer Gang für uns und ich war froh, dass Leon dies übernahm, weil ich fürchtete, dabei dann nicht
mehr Herr meiner Gefühle zu sein.*
Ebenfalls ein Umdenken beziehungsweise eine Weiterentwicklung hat das Konzept der Neurodiversität in den letzten
Jahren erfahren. Dieses Konzept stammt zwar bereits aus den 1990er-Jahren und wird den beiden autistischen
Aktivisten Judy Singer und John Sinclair unabhängig voneinander zugeschreiben, aber ins Bewusstsein einer
breiteren Menge von Personen ist es erst im Laufe der letzten zehn bis fünfzehn Jahren gelangt. Neurodiversität ist
ein Konzept, welches typische und atypische neurobiologische Entwicklungen als menschliche Disposition ansieht.
Nach diesem Konzept sind alle Menschen als neurodivers zu betrachten, weil sich alle Gehirne in ihrem Aufbau und
in ihrer Struktur ähneln, aber unterschiedlich funktionieren können. Menschen, die sich entsprechend den
medizinischen und psychologischen Normen entwickeln, werden als neurotypisch bezeichnet. Menschen, deren
Entwicklung von diesen Normen abweicht, sind neurodivergent.
Viele Therapien waren um die Jahrtausendwende darauf ausgerichtet, dass autistische Kinder lernen, sich wie nicht-
autistische Kinder zu verhalten, denn nur dann seien sie in der Lage, eine Regelschule zu besuchen. Dazu kamen
verschiedene Formen von Verhaltenstherapie zum Einsatz, die inzwischen stark in die Kritik geraten sind, weil unter
anderem inzwischen erkannt wurde, dass diese als Maskieren bezeichneten Verhaltensweisen negative
Folgeerscheinungen wie psychische Erkrankungen nach sich ziehen können. Ebenfalls kritisch wird heute
betrachtet, dass verhaltenstherapeutische Maßnahmen das intrinsische Lernen nicht fördern, sondern eher
behindern.
Etwas, was es vor 25 Jahren noch nicht gab, ist eine Summe aus Verhaltensauffälligkeiten, die als PDA (Pathological
Demand Avoidance, Krankhafte Vermeidung von Anforderungen) bezeichnet wird. PDA ist keine eigenständige
Diagnose, sondern beschreibt eine Reihe von Besonderheiten im Verhalten, wenn an das Kind Anforderungen von
außen herangetragen werden, die eigentlich zu bewältigen sind. Dies tritt sowohl bei autistischen Kindern als auch
bei Kindern mit anderen Entwicklungsstörungen auf. Es bleibt abzuwarten, ob PDA in irgendeiner Weise Eingang in
die nächste Überarbeitung der Diagnosekriterien für Autismus finden oder eventuell sogar eine eigenständige
Diagnose bilden wird.
Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass Eltern autistischer Kinder in letzter Zeit vermehrt in den nicht
wohlwollenden Blick von einigen Fachpersonen geraten. Vor 25 Jahren war es gerade gelungen, sich vom
Kühlschrankmutter-Konzept endgültig zu lösen und die biologischen Ursachen von Autismus anzuerkennen. Dies
wird zwar heute meist nicht bestritten, aber wenn auf Tagungen von renommierten Fachpersonen davon gesprochen
wird, dass Eltern das autistische Verhalten ihrer Kinder verstärken und dass Eltern deshalb endlich wieder kritisch in
den Blick genommen werden dürfen beziehungsweise müssen, dann finde ich dies recht besorgniserregend. Eltern
und Fachpersonen sollten nicht nur gemeinsam an einem Strang ziehen, sondern auch am selben Ende, um das
Beste für das autistische Kind zu erreichen.
* Zitat aus „Mami, ich habe eine Anguckallergie“, Maus, 2013, Engelsdorfer Verlag